Toxische Positivität
Wenn positives Denken ungesund wird
Optimismus gilt als Schlüssel zu mehr Resilienz, Zufriedenheit und einem langen Leben. Tatsächlich belegen zahlreiche Studien: Eine positive Einstellung fördert die psychische und körperliche Gesundheit. Doch wie bei allem, was übertrieben wird, kann auch Positivität ins Gegenteil kippen. Wer unangenehmen Gefühlen keinen Raum mehr gibt und ständig nur „Good vibes only“ predigt, gerät in eine Falle – die der toxische Positivität.
Positive Emotionen haben ohne Zweifel enorme Vorteile. Menschen, die optimistisch denken, erholen sich schneller von Krisen, sind seltener depressiv und leben im Schnitt länger. Die Psychologie spricht hier von einem „positiven Bias“: Wir neigen dazu, die Welt etwas rosiger wahrzunehmen, als sie tatsächlich ist – und genau das schützt uns vor dem Absturz in Pessimismus.
Problematisch wird es jedoch, wenn negative Emotionen nicht mehr erlaubt sind. Der Anspruch, immer gut drauf zu sein, jede Krise als Chance zu sehen und schlechte Gefühle sofort wegzuschieben, ist nicht nur unrealistisch, sondern auch schädlich.
„Stell dich nicht so an“, „Denk positiv“, „Sei dankbar, anderen geht’s schlechter“ – solche Sätze klingen harmlos, doch sie entwerten echte Emotionen. Wer lernt, Trauer, Angst oder Wut zu unterdrücken, entfernt sich ein Stück von sich selbst.
Was die Forschung zeigt
Bereits 2006 belegte die amerikanische Forscherin Laura Campbell-Sills, dass das Unterdrücken negativer Gefühle kontraproduktiv ist. Proband:innen, die ihre Emotionen einfach akzeptierten, zeigten danach niedrigere Herzfrequenzen und weniger Stresssymptome als jene, die versuchten, Gefühle wegzuschieben.
Auch Iris Mauss von der University of Denver fand 2011 heraus, dass Menschen, die Glück besonders stark bewerten, oft weniger intensive Glücksgefühle erleben – schlicht, weil sie enttäuscht sind, den eigenen Erwartungen nicht zu genügen. In späteren Studien wurde sogar ein Zusammenhang zwischen dem ständigen Streben nach Glück und Depressionen festgestellt.
Besonders spannend ist eine Untersuchung des Psychologen Egon Dejonckheere (2022). Er zeigte: In Ländern mit einem hohen Glücksindex – also in vermeintlich besonders „glücklichen Nationen“ – empfinden viele Menschen verstärkten Druck, glücklich sein zu müssen. Paradox, aber real: Ein gesellschaftlicher Glücksanspruch kann individuelles Wohlbefinden mindern.
Der Social-Media-Effekt
Instagram, Pinterest, TikTok – überall prangen Slogans wie „Good vibes only“ oder „Happiness is a choice“. Solche Botschaften verstärken den Eindruck, negative Gefühle seien unangebracht. Gerade während Krisenzeiten wie Pandemie, Krieg oder Naturkatastrophen ist das fatal. Menschen, die ohnehin belastet sind, fühlen sich zusätzlich schuldig, wenn sie nicht positiv genug denken.
Toxische Positivität macht also nicht glücklicher – sie isoliert. Wer immer so tut, als sei alles perfekt, verliert den Zugang zu echter Verbundenheit. Denn Nähe entsteht nicht durch Daueroptimismus, sondern durch das Teilen der ganzen Gefühlspalette – von Freude bis Trauer.
Gesunde Positivität: Der Mittelweg
Die Lösung ist kein Pessimismus, sondern gesunder Optimismus. Das bedeutet: Hoffnung auf ein gutes Ende bewahren, ohne negative Gefühle zu verdrängen. Akzeptanz ist der erste Schritt – Angst, Ärger und Trauer dürfen sein.
Praktische Ansätze:
Reframing: Emotionen neu einordnen, ohne sie kleinzureden. Ärger kann ein Signal für Grenzüberschreitung sein, Angst ein Hinweis auf Gefahren.
Achtsamkeit: Gefühle wahrnehmen, ohne sofort zu reagieren. Studien zeigen, dass Achtsamkeitsübungen helfen, Emotionen zu integrieren, statt sie abzuwehren.
Realistische Hoffnung: Optimisten sehen Probleme klar, behalten aber die Möglichkeit im Blick, dass Dinge sich verbessern können.
Positive Psychologie vs. Toxische Positivität
Oft wird toxische Positivität mit Positiver Psychologie verwechselt. Dabei ist das ein Missverständnis. Die Positive Psychologie fordert nicht, negative Emotionen auszublenden – im Gegenteil. Sie betont die Balance: Freude, Sinn, Beziehungen und Stärken entwickeln, ohne die dunklen Seiten des Lebens zu leugnen.
Ihr Ziel ist nicht, Menschen dauerhaft fröhlich zu machen, sondern ihnen Werkzeuge zu geben, auch mit schwierigen Phasen konstruktiv umzugehen. Achtsamkeit, Resilienz und Sinnfindung gehören genauso dazu wie Glücksmomente.
Fazit: Erlaub dir die ganze Gefühlsskala
Toxische Positivität schneidet uns von unseren echten Emotionen ab. Gesunde Positivität hingegen erlaubt, dass Trauer, Angst und Wut genauso Raum haben dürfen wie Freude, Liebe und Dankbarkeit.
Das entscheidende Learning: Du musst nicht immer positiv sein, um ein gutes Leben zu führen. Wahres Glück entsteht, wenn wir uns selbst und andere in allen Facetten annehmen – mit Licht und Schatten.
Quellen
Campbell-Sills, L. et al. (2006). Emotion regulation in anxiety and mood disorders. Journal of Abnormal Psychology. https://doi.org/10.1037/0021-843X.115.1.68
Mauss, I. et al. (2011). Can seeking happiness make people unhappy? Emotion. https://doi.org/10.1037/a0022010
Dejonckheere, E. et al. (2022). Perceived societal pressure to be happy and its link to well-being. Journal of Positive Psychology. https://doi.org/10.1080/17439760.2022.2059035
World Happiness Report (2023). Sustainable Development Solutions Network. https://worldhappiness.report/ed/2023/
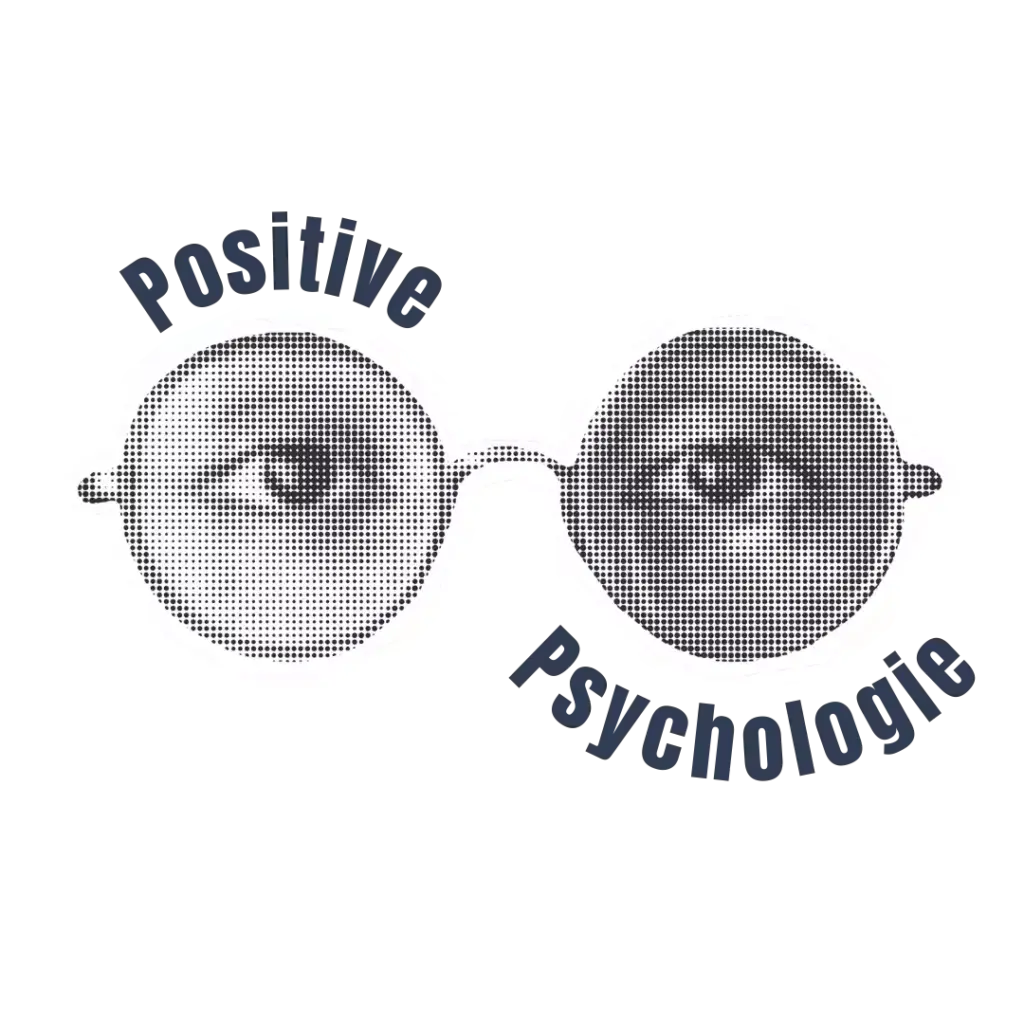








Ein Kommentar