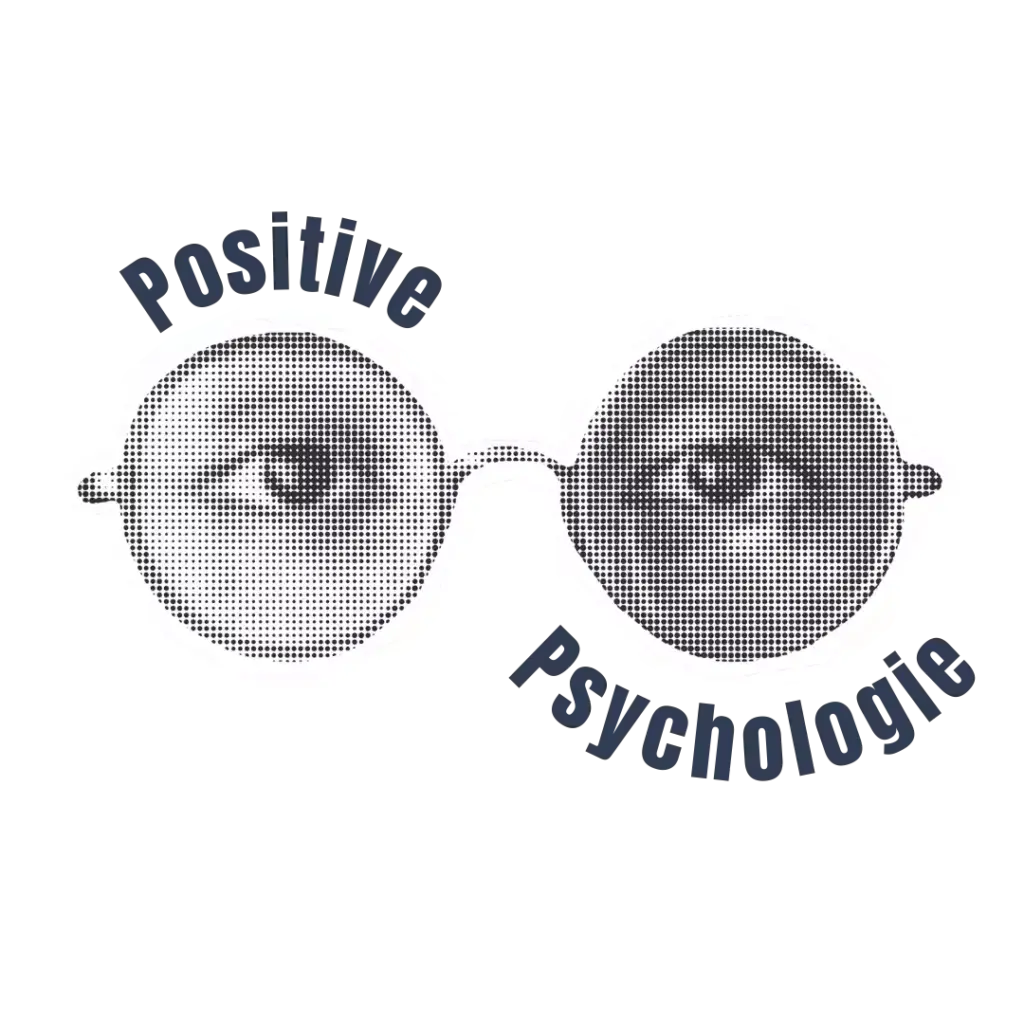Glücklich in Krisenzeiten
Warum positive Psychologie uns stark macht
Krisen gehören zum Leben. Manche treffen uns ganz persönlich – eine Krankheit, ein Jobverlust, das Ende einer Beziehung. Andere betreffen uns kollektiv und scheinen größer als wir selbst: Kriege, Naturkatastrophen, politische Unsicherheit oder wirtschaftliche Einbrüche. Im Jahr 2025 blicken wir täglich auf Nachrichten, die uns erschüttern: der anhaltende Konflikt in Gaza und Israel, schwere Erdbeben in Asien, Waldbrände in Kalifornien, Überschwemmungen in Südeuropa. All das prägt unsere Gedanken und Gefühle – und wir stellen uns unweigerlich die Frage: Darf ich in solchen Zeiten überhaupt glücklich sein?
Die positive Psychologie gibt uns darauf eine klare Antwort: Ja, wir dürfen. Mehr noch – wir sollten sogar. Denn gerade in Krisenzeiten ist es entscheidend, Momente von Freude, Hoffnung und innerer Stärke zuzulassen. Glücklich sein in Krisenzeiten bedeutet nicht, Leid zu ignorieren. Es bedeutet, sich selbst zu stabilisieren, um handlungsfähig zu bleiben – für uns und für andere.
Warum Glück in Krisenzeiten möglich ist
Die Glücksforschung zeigt, dass Menschen erstaunlich resilient sind. Selbst nach schweren Katastrophen, nach Kriegen oder persönlichen Schicksalsschlägen gelingt es vielen, wieder positive Emotionen zu empfinden. Das liegt daran, dass unser Gehirn nicht nur auf Gefahren programmiert ist, sondern auch auf das Suchen nach Sinn und Freude.
Die Psychologin Barbara Fredrickson hat mit ihrer Broaden-and-Build-Theorie erklärt, wie positive Emotionen in uns wirken: Während Angst, Trauer oder Wut unseren Blick verengen und auf das Problem fokussieren, erweitern positive Emotionen wie Dankbarkeit, Freude oder Hoffnung unseren Horizont. Wir sehen neue Möglichkeiten, knüpfen stärkere soziale Kontakte und entwickeln kreative Lösungen. In Krisenzeiten ist das keine Luxusfunktion – es ist Überlebensstrategie.
Negative Emotionen sind wichtig – aber nicht alles
Natürlich: Niemand kann oder soll sich dauerhaft fröhlich fühlen, wenn die Welt brennt. Negative Emotionen sind ein natürlicher Teil unseres Erlebens. Angst sorgt dafür, dass wir vorsichtig sind. Wut kann uns mobilisieren, Ungerechtigkeiten anzugehen. Trauer hilft, Verlust zu verarbeiten.
Doch wenn diese Gefühle überhandnehmen, blockieren sie uns. Wer den ganzen Tag Nachrichten konsumiert, die nur von Gewalt, Zerstörung und Katastrophen berichten, verliert die Fähigkeit, den Blick zu heben. Studien zeigen, dass ein dauerhaft negatives Gedankenkarussell zu Hilflosigkeit und Depression führen kann. Deshalb ist es so wichtig, einen bewussten Umgang zu finden: Nachrichten dosieren, eigene Pausen schaffen und Raum für Positives zulassen.
Positive Psychologie in der Praxis: Glücklich sein in Krisenzeiten
Die positive Psychologie beschäftigt sich seit Jahren damit, wie wir gezielt positive Emotionen fördern können – nicht, um die Realität zu verleugnen, sondern um unsere Widerstandskraft zu stärken. Gerade in Zeiten wie jetzt können diese Ansätze helfen:
1. Dankbarkeit als Gegengewicht
Dankbarkeitstagebücher gehören zu den am besten erforschten Methoden. Schon drei kleine Dinge pro Tag, für die du dankbar bist, können dein Wohlbefinden messbar steigern. Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, den Blick nicht nur auf Mangel und Verlust zu richten, sondern bewusst auf das, was noch trägt: Gesundheit, Beziehungen, kleine alltägliche Freuden.
2. Achtsamkeit und Medienkonsum
Viele Menschen berichten, dass sie sich ausgeliefert fühlen, wenn sie permanent Nachrichten über Krieg, Zerstörung oder Katastrophen konsumieren. Achtsamkeit bedeutet, bewusst Grenzen zu setzen: nur einmal am Tag Nachrichten schauen, zwischendurch bewusst in die Natur gehen, einen Moment Stille oder Meditation einbauen. Studien zeigen, dass regelmäßige Achtsamkeitspraxis Stress reduziert und die Resilienz stärkt.
3. Soziale Verbundenheit
Krisen zeigen immer wieder: Allein schaffen wir es kaum, gemeinsam viel eher. Positive Psychologie betont den Wert sozialer Beziehungen. Freunde, Familie, Gemeinschaften geben Halt – sei es durch Gespräche, gemeinsames Handeln oder einfach das Gefühl, nicht allein zu sein. Selbst kleine Gesten wie ein Telefonat oder ein Spaziergang mit einer vertrauten Person können die Stimmung deutlich verbessern.
4. Sinn und Hilfe
Viele Menschen empfinden ihr Glück in Krisenzeiten nicht im Rückzug, sondern im Helfen. Ehrenamt, Spenden oder auch kleine Gesten im Alltag können ein starkes Gefühl von Sinn stiften. Das zeigt auch die Glücksforschung: Menschen, die etwas für andere tun, berichten von höherem Wohlbefinden – selbst dann, wenn sie sich zuvor machtlos gefühlt haben.
Krisen als Wendepunkte für persönliches Wachstum
Krisen sind schmerzhaft – und doch können sie uns verändern. Forschungen zur sogenannten posttraumatischen Reifung zeigen, dass viele Menschen nach schweren Krisen nicht nur zurück ins Leben finden, sondern langfristig mehr Lebenszufriedenheit berichten. Sie erkennen klarer, was wirklich zählt, pflegen intensivere Beziehungen und entwickeln neue Werte.
Das bedeutet nicht, dass Krisen per se „gut“ sind. Aber sie können uns lehren, loszulassen, neu zu beginnen und unser Glück neu zu definieren. Der Herbst, der uns lehrt, Blätter fallen zu lassen, damit im Frühling neues Leben wachsen kann, ist eine passende Metapher: Auch in Krisenzeiten dürfen wir vertrauen, dass Wandel neue Chancen bringt.
Global denken, lokal handeln
Angesichts globaler Krisen fühlen wir uns oft ohnmächtig. Doch Glück und Resilienz entstehen nicht aus dem Versuch, die ganze Welt zu retten, sondern aus konkreten Schritten im eigenen Umfeld. Wer im Alltag bewusst auf positive Erlebnisse achtet, sich engagiert, soziale Kontakte pflegt und die eigenen Ressourcen schützt, bleibt stabil – und kann dadurch auch mehr für andere tun.
Glücklich in Krisenzeiten bedeutet also: nicht wegsehen, aber auch nicht untergehen. Es geht darum, einen inneren Anker zu finden, der uns trägt, während die Welt sich im Sturm befindet.
Fazit: Glück ist erlaubt – gerade jetzt
Krisen sind Teil unseres Lebens. Sie fordern uns heraus, sie erschüttern uns, und manchmal lassen sie uns an der Welt zweifeln. Aber genau dann ist Glück kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Positive Psychologie zeigt: Wir können lernen, Freude und Hoffnung auch in dunklen Zeiten zuzulassen – und dadurch stärker, handlungsfähiger und menschlicher werden.
Also: Ja, du darfst tanzen, lachen und lieben, auch wenn draußen die Welt Kopf steht. Denn nur so entsteht die Kraft, die wir brauchen, um Krisen gemeinsam zu meistern.
Quellen
Fredrickson, B. L. (2013). Positive Emotions Broaden and Build. Advances in Experimental Social Psychology, 47, 1–53. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-407236-7.00001-2
Quoidbach, J., Mikolajczak, M., & Gross, J. J. (2015). Positive interventions: An emotion regulation perspective. Psychological Bulletin, 141(3), 655–693. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-407236-7.00001-2
World Happiness Report (2024). Sustainable Development Solutions Network. https://www.worldhappiness.report
American Psychological Association (2023). Resilience in a time of war and crisis.